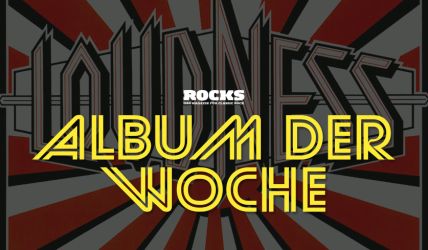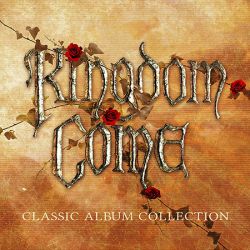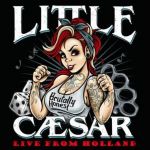Den Grundstein des enormen Erfolges, den Kingdom Come vor allem in den USA erlebten, legte vor allem ›What Love Can Be‹. Der vierte Song ihres Erstlingswerks ist ganz anders als die Power-Balladen, die für gewöhnlich über den Verstärker von MTV neue Hardrock-Helden ausrufen. Es ist ein ungemein schwermütiger und dramatisch klagender Heavy Blues im Achtziger-Gewand, der wenig subtil mit dem ersten hörbaren Atemzug des Sängers klar macht, auf wen er sich beruft: ›Since I’ve Been Loving You‹ und Led Zeppelin.
»Das muss man sich vorstellen«, erinnert sich Wolf: »Wir waren mit dem Produzenten Bob Rock in New York im Studio beim Mischen, als A&R-Guru John Kalodner diese Nummer hörte und so begeistert war, dass er sofort ein Tape haben wollte. Das landete dann irgendwie bei einer Radiostation in Detroit, die es rauf und runter gespielt hat. Angeblich fiel denen danach das Telefon aus der Wand, weil alle Welt wissen wollte, wie diese Band hieß. Du kannst das ganze Land mit Plakaten zukleistern und dann vielleicht fünf Platten verkaufen, aber der richtige Song zur richtigen Zeit bewirkt Wunder. In unserem Fall wurde daraus ein richtiges Lauffeuer.«
Die wundersame Geschichte von Kingdom Come begann einige Jahre zuvor mit Lenny Wolfs erster Band Funhouse und ihrem Gitarristen Norbert Pape, der in den Staaten mit schwer erhältlichen Mikrophonen dealte. Sein Geschäftspartner Marty Wolffe, Lichtdirektor der Doobie Brothers und Wolfs späterer Manager, hörte ein Demo — und war beeindruckt von der Stimme, die dort erklang. Umgehend bat er den Sänger zu sich in die USA: Für den nicht gerade wortgewandten Großstadtbengel ein Trip ins Ungewisse. »Obwohl ich nur drei Brocken Englisch konnte, habe ich keine Sekunde gezögert und bin nach L.A. gezogen. Dort hat mich Marty mit Bruce Gowdy bekanntgemacht, der eher aus der Progressive-Ecke kam, aber mit mir als Rocker vom Hamburger Kopfsteinpflaster prächtig klarkam.« Sie starteten Stone Fury, wurden 1983 von einer großen Plattenfirma unter Vertrag genommen und sind bereit, ordentlich durchzustarten.
»Zuerst war das alles ziemlich geil. Wir waren mit dem legendären Produzenten Andy Johns im Studio, und das Debüt Burns Like A Star enthält schon einige Elemente, die später für Kingdom Come charakteristisch waren. Aber die zweite Scheibe war eine absolute Katastrophe. Wir sollten mit dem Country-Produzenten Richard Landis zusammenarbeiten und das ging völlig in die Hose. Ich konnte null vermitteln, was ich eigentlich wollte und was mich alles störte, und irgendwann wurde ich aus dem Studio geworfen. Let Them Talk hat mir geschadet, dir nimmt keiner den Rocker ab, wenn du so eine Weichei-Platte auf der Weste hast. Ich kann mich gar nicht genug bei Derek Shulman bedanken, dass er mir nach dem Stone-Fury-Flop einen Gnaden-Deal anbot.«
Der einstige Sänger von Gentle Giant war inzwischen für Polygram tätig und gerade auf der Suche nach einer Truppe, die den Geist der Siebziger in die späten Achtziger zu übertragen vermochte. Seine Bedingung für einen Deal: Wolf brauchte eine Band. Die war schnell gefunden. »Bei James Kottak, dem Schlagzeuger, wusste ich nach zwei Minuten, dass er mein Mann ist. Er brachte Rick Steier als Rhythmus-Gitarristen mit. Und Danny Stag, der andere Gitarrist, war totaler Hendrix-Fanatiker und hatte einen unglaublichen Ton. Außerdem war er freundlich und enthusiastisch — und ein wandelnder Schornstein. Und Bassist Johnny B. Frank war einfach cool. Ein guter Musiker und mit seiner total ruhigen Art der ideale Gegenpol zu mir.«
Schnell kristallisierte sich heraus, wo sich der Kernmarkt von Kingdom Come befand: Während sie in Deutschland und England bescheiden im Vorprogramm von Magnum tourten, stieg ihre von dem noch wenig bekannten Bob Rock produzierte Platte direkt auf Platz zwölf der amerikanischen Billboard-Charts ein: Ein enormer Kassenschlager, der die Formation zu Van Halen, Metallica und den Scorpions auf das Billing der amerikanischen Monsters Of Rock-Festivals brachte — im Anschluss nahmen die Hannoveraner sie mit auf ihrer Savage Amusement-Tournee durch die USA.
Gegenwind bekamen Kingdom Come vor allem in Europa: Ein Deutscher, der auszog, um den amerikanischen Traum zu leben, war eine Sache, die man jemandem gönnen konnte — oder eben nicht. Die schwer zu überhörbare Ähnlichkeit zum Stil und dem Gestus von Led Zeppelin aber stießen auch auf ganz rational erklärbare Ablehnung und Gehässigkeiten. Selbst Jimmy Page, meldet sich immer wieder in der Presse zu Wort: »Wenn sogar die Riffs eins zu eins übernommen werden, ist es kein Kompliment mehr, sondern nur ärgerlich.« Dabei hat das Album alles, was das Herz begehrt — wirklichen Siebziger-Vibe ausgenommen, denn die latent unterkühlte Atmosphäre solcher Hymnen wie ›Livin’ Out Of Touch‹ sind ebenso eindeutig auf die späten Achtziger ausgerichtet wie die cool groovenden Riffs (›17‹) und in Wucht verpackte Dramatik (›Pushin’ Hard‹).
Der Gescholtene sieht es heute gelassen. »Ich war einfach nur stolz, dass die Scheibe fertig war. Wir hatten nie vor, Led Zeppelin zu kopieren — Danny war nicht mal Jimmy Page-Fan. Die Scheiße flog uns damals echt mit Karacho um die Ohren, aber schon Led Zep wurde ja permanent vorgeworfen, die alten Blues-Männer zu kopieren.«
Das zweite Album In Your Face (1989) schleift Produzent Keith Olsen später erheblich und inszeniert die Combo bis ins Mark amerikanisch: Längst nicht alles ist mit dem Bleizeppelin verwurzelt, wie ›Do You Like It‹ oder das famose ›Stargazer‹ zeigen. Auch ›Gotta Go (Can’t Wage A War)‹ steht einer zeitgenössischen US-Gruppe wie Great White bedeutend näher. Bei Stücken wie ›Mean Dirty Joe‹ hingegen gibt es gar kein Vertun. Kommerziell ein Flop.
Auf Hands Of Time (1991) lässt sich Wolf von Gastmusikern wie Gitarrist Blues Saraceno unterstützen, den Rest erledigt er im Studio überwiegend selbst. ›I’ve Been Trying‹ reizt mit mittelalterlich anmutenden Folk-Adaptionen und schwerem Rhythmus. Im clever AC/DC zitierenden ›Stay‹ treibt Wolf seinen bis dato wunderbarsten Refrain zur Blüte. Mit Hands Of Time beginnt sich der Sänger neu zu ordnen: Die kalten Keyboardschwaden und beinahe stoischen Grooves, die Lieder wie ›Both Of Us‹ oder besonders ›Should I‹ bestimmen, werden als Stilmittel auf den Folgewerken immer wichtiger. Damals stärker irritierend als heute: Das Schlagzeug klingt zuweilen nach Drum-Computer.