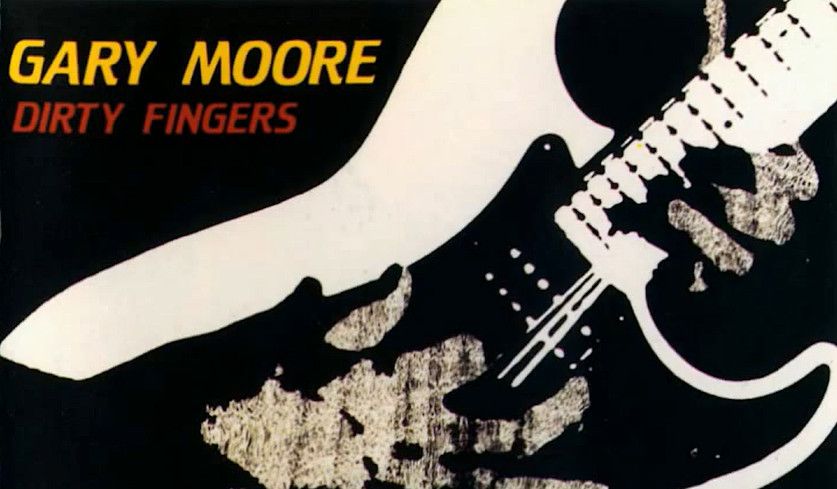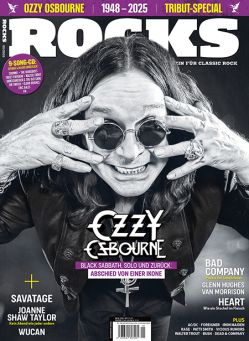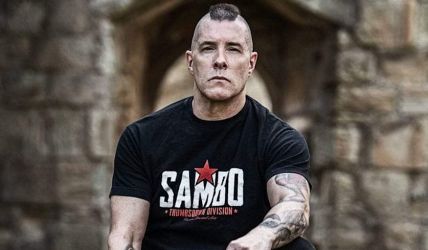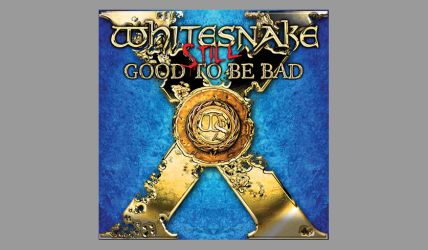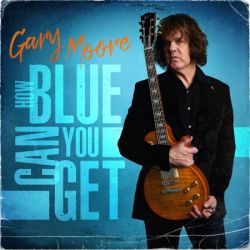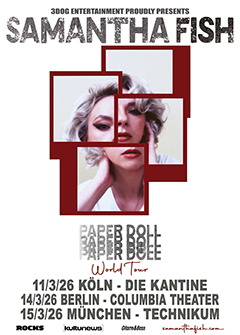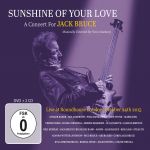Seine musikalischen Anfänge sind heute weitgehend im Nebel der Vergangenheit verborgen. Mit den Dubliner Progressive-Bluesern Skid Row nimmt Moore die beiden Alben Skid (1970) und 34 Hours (1971) auf. Eine Tour im Vorprogramm von Fleetwood Mac beeindruckt den jungen Musiker nachhaltig, besonders Gitarrist Peter Green schärft seine Sinne für den Blues, eine Liebe, die ihn sein ganzes Leben nicht mehr loslässt. Dennoch findet er in seinen frühen Jahren nicht zur Ruhe und noch weniger zu Disziplin. Hardrock, irischer Folk, Jazz-Fusion oder Blues — Gary Moore kann und will sich nicht festlegen. Die Folk-Rocker Dr. Strangely Strange verlässt er schnell wieder, um seiner musikalischen Zielsetzung mit seiner eigenen Gary Moore Band und dem LP-Debüt Grinding Stone (1973) ein Stück näher zu kommen. Das trägt stolz eine gewisse Affinität zum amerikanischen Musik-Adel zur Schau, den der Musiker bewundert.
»Wir haben schon über den großen Teich geschielt und die Entwicklung von Bands wie den Allman Brothers genau verfolgt, dagegen waren Skid Row ja blutige Amateure«, bekennt der Nordire später. »Als Solokünstler hätte mich diese etwas eklektische Richtung gereizt, doch der Chef in meiner eigenen Band zu sein hatte ich mir erheblich einfacher vorgestellt. Ich war der Verantwortung einfach nicht gewachsen und erlitt sogar einen Nervenzusammenbruch.«
Der Möglichkeit, den aufstrebenden Rockern Thin Lizzy als zweiter Gitarrist ohne weitere Führungsaufgaben im Vorfeld der Aufnahmen zu deren Album Nightlife (1974) beizutreten, nimmt Moore deshalb dankend an. Doch mit dem Erfolg kommen auch die Ausschweifungen, zu Drogen- und Alkoholkonsum lässt er sich gerne verführen. Musikalisch allerdings strebt er weiterhin nach Höherem. Er kündigt seinen Job bei Thin Lizzy blitzartig, um mit dem komplexen Jazz-Rock von Colosseum II eine weitere Kehrtwendung zu unternehmen und sodann in Zusammenarbeit mit Phil Lynott sein zweites Solo-Album Back On The Streets (1978) zu realisieren. Nicht nur bei ›Parisienne Walkways‹, dem Hit der Scheibe, ist der Lizzy-Anführer zu hören; im Gegenzug erneuert Moore seinen Pakt mit der Blech-Liesel, die im hochgelobten Album Black Rose (1979) mündet.
Dass er zwar ein begnadeter Künstler, jedoch alles andere als ein Teamplayer sei, kritisiert sein Gitarren-Partner Scott Gorham schon nach kurzer Zusammenarbeit. Und es war absehbar: Nur ein knappes Jahr nach seinem Einstieg verabschiedet Moore sich wieder. Don Arden, mächtiger Medien-Mogul und Vater von Sharon Osbourne, sieht in ›Parisienne Walkways‹ einen kommerziellen Ansatz und lässt ihn in Los Angeles mit Ted Nugent-Sänger Charlie Huhn, dem späteren Deep Purple-Keyboarder Don Airey, dem ehemaligen Rainbow-Bassisten Jimmy Bain und Black Oak Arkansas- und Pat Travers-Trommler Tommy Aldridge eine im Endeffekt nur kurzlebige „Supergroup“ für sein Label Jet Records formieren. Zwar nennt Sharon Moores Ausstieg bei Thin Lizzy später „den größten Fehler seiner Karriere“, doch zunächst arbeitet die namenlose Truppe zwischen 1980 und 1981 unter der Regie von Produzent Chris Tsangarides an ihrem einzigen Album.
Die Aufnahmen sind in doppelter Hinsicht legendär: Nie in letzter Konsequenz fertiggestellt oder gar zur Veröffentlichung freigegeben, bereitet die Scheibe den Weg für Corridors Of Power, dem mit Abstand feurigsten Werk seiner kompletten Solokarriere. Dirty Fingers ist ein ungestümes und ungezähmtes Biest von einem Album, geprägt von sensationeller Gitarrenarbeit und mit kernigen Liedern wie den kratzbürstigen und kompromisslosen Rockern ›Kidnapped‹, ›Run To Your Mama‹ oder ›Lonely Night‹. ›Rest In Peace‹ mag qualitativ nicht an seinen späteren Hit ›Empty Rooms‹ heranreichen, belegt jedoch das Händchen des Ausnahmemusikers für balladeske Töne und luftige Soli. Seinen Ruf als Gitarren-Gott des kommenden Jahrzehnts festigt vor allem das melodische ›Nuclear Attack‹, das, wie auch ›Hiroshima‹, die Gefahren einer nuklearen Bedrohung besingt, ein Thema, das sich später auch in Liedern wie ›End Of The World‹ oder ›After The War‹ wiederfinden sollte. Dass Moore ›Really Gonna Rock Tonight‹ später in ›Rockin’ Every Night‹ recycelt, ist zu verschmerzen, besser gelungen ist die Hardrock-Coverversion des Animals-Hits ›Don’t Let Me Be Misunderstood‹.
Doch Don Arden, angeblich unzufrieden, weil ein geplanter US-Deal nicht zustande kommt, hält Dirty Fingers vorerst unter Verschluss und veröffentlicht die Scheibe erst drei Jahre später im Zuge des Erfolgs von Corridors Of Power, zeitgleich mit der interessanten Konzert-Nachlese Live At The Marquee. Für Moore ein Karriere-Rückschlag, von dem er sich jedoch nicht entmutigen lässt. Eine geplante Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Deep Purple-Sänger und Bassisten Glenn Hughes scheitert zwar an dessen Drogenabhängigkeit, dafür stampft er mit Bassist Tony Newton, dem Ian Gillan-Schlagzeuger Mark Nauseef und Sänger Willie Dee die wiederum kurzlebigen G-Force aus dem Boden. Ihr einziges Album, das dem Musiker dann doch noch eine Veröffentlichung im Jahre 1980 beschert, vereint Heavy Rock mit ungewohnten Pop-Tönen und klingt zudem im Gitarren-Bereich gewollt synthetisch. Wohl auch, weil die einzige Single ›Hot Gossip‹ floppt, löst Moore G-Force umgehend auf und konzentriert sich fortan auf seine Stärken. Er beginnt einen unaufhaltsamen Aufstieg zum Gitarren-Idol einer ganzen Generation mit Corridors Of Power und macht sich mit dem nachfolgenden Meisterstück Victims Of The Future unsterblich.
Dieser Text stammt aus ►ROCKS Nr. 101 (04/2024).