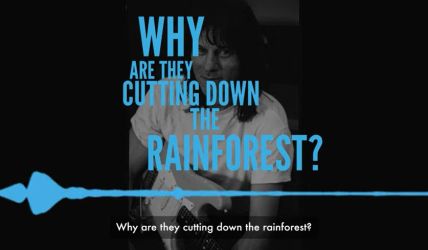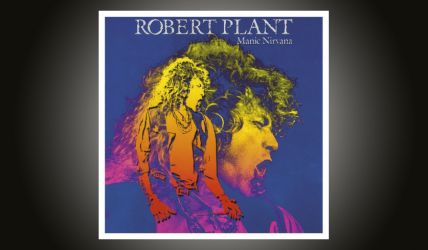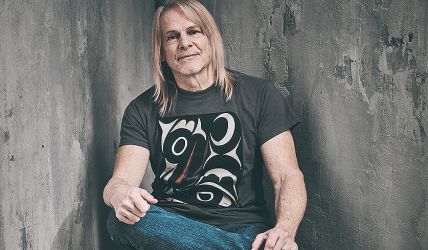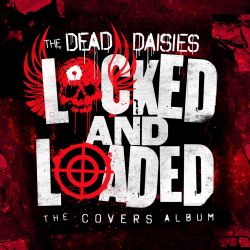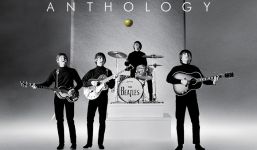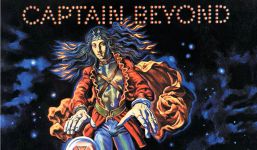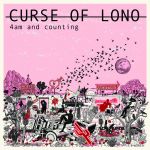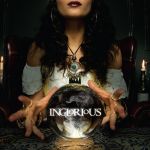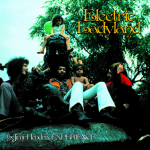Muscle Shoals ist ein verschlafenes Örtchen in Alabama. Und namentlich gleichwohl weltweit bekannt. Zu verdanken hat es die Kleinstadt den dort ansässigen Fame Studios — und natürlich Lynyrd Skynyrd, die mit der Textzeile „Now Muscle Shoals has got the Swampers“ aus ihrem Klassiker ›Sweet Home Alabama‹ beiden ein ewiges Denkmal setzten. Zahlreiche Blues- und Soul-Legenden wie Otis Redding, Aretha Franklin oder Etta James spielten dort ihre Musik ein und ließen sich dabei gerne unterstützen von der lokalen Studioband The Swampers. Auch Duane Allman begann dort seine Karriere: Der Gitarrist campte 1968 auf dem Parkplatz vor dem Studio, um bei möglichen Aufnahmen direkt vor Ort zu sein — später bekam er dort tatsächlich einen Vertrag als Studiomusiker. Seine legendären Tage hat das Studio mittlerweile hinter sich, möglich ist die Arbeit dort aber nach wie vor. In musealem Ambiente, wie Dead Daisies-Frontmann John Corabi freudig erzählt.
»Es ist faszinierend: Alles dort atmet Geschichte. Jeden Abend gegen 17 Uhr gibt es eine Führung. Währenddessen haben wir eine Pause gemacht und uns etwas zu trinken besorgt. Statt uns in unsere Hotelzimmer zu verkriechen, beschlossen wir, Songs wie ›Born Under A Bad Sign‹ oder ›Crossroads‹ zu jammen. Weil das auf Anhieb ziemlich cool klang, haben wir jeden Tag nach der Arbeit an Light ’Em Up Coverversionen arrangiert und aufgenommen«, berichtet der Sänger begeistert, wie die Band quasi nebenbei ein zweites Album einspielte.
»Wir haben außerdem festgestellt, dass wir sogar eine indirekte Verbindung zu dem Ort haben. Einige der Leute des Fame-Studios haben später einige Kilometer weiter ein neues Studio gegründet, in dem die Rolling Stones, Bob Seger und Rod Stewart gearbeitet haben. Von dem dortigen Team haben sich später wiederum einige selbstständig gemacht und in Nashville niedergelassen. Das Studio, das sie dort gründeten, kaufte unser Stammproduzent Marti Frederiksen, als er in die Stadt zog. Und dort haben wir 2017 Make Some Noise und ein Jahr später Burn It Down aufgenommen.«
Derlei Querverbindungen brachte die Band nicht nur an einen einflussreichen Ort der Musikgeschichte, sondern auch zu ebensolchen Songs: Originäre Blues-Aficionados seien sie nämlich nicht, gesteht Corabi. Entdeckt haben sie den Sound, wie viele ihrer Generation, erst über die Interpretationen von vornehmlich britischen Rockbands.
»Der Blues hat in fast allen Genres seine Spuren hinterlassen, abgesehen vielleicht von klassischer Musik. Das ist mir erst während der Arbeit an der Platte so richtig klargeworden. Es war eine ur-amerikanische Kunstform, die ihren Weg nach England fand. Die Jungs dort machten sich zu eigen, was hier nur mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen wurde. Für die meisten weißen Amerikaner war das Voodoo-Musik. Bands wie die Stones, Led Zeppelin oder Cream überarbeiteten die Nummern und brachten sie in den sechziger und siebziger Jahren wieder hierher zurück. Das waren die Bands, die mich zum ursprünglichen Blues geführt haben — auch wenn ich das lange nicht wusste. ›Crossroads‹ ist so ein persönliches Beispiel. Ich habe die Nummer zum ersten Mal in der Version von Cream gehört. Oder ›When The Levee Breaks‹: Was für ein brillantes, episches Ende für Led Zeppelin IV! Mit etwas Recherche stellt sich aber raus, dass das Stück bereits 1929 von Memphis Minnie über die Mississippi-Flut zwei Jahre zuvor geschrieben wurde. Led Zeppelin haben nur den Text beibehalten und ein neues Arrangement dazu geschaffen. Looking For Trouble ist unsere Art, den Leuten zu danken, die diese Songs ursprünglich erdacht haben. Sozusagen ein Tribut an die Inspirationen unserer Inspirationen.«
Auf Looking For Trouble nimmt sich die Könner-Formation um den ehemaligen The Scream- und Mötley Crüe-Frontmann Corabi und den langjährigen Whitesnake-Gitarristen Doug Aldrich vornehmlich allseits bekannter Klassiker des Genres an. Neben dem Albert King-Standard ›Born Under A Bad Sign‹ sowie den Robert Johnson-Nummern ›Crossroads‹ und ›Sweet Home Chicago‹ kleidet sie etwa auch den treibenden Freddie King-Song ›Going Down‹ in hart rockende Gewänder. Und ließ sich dazu auch von späteren Interpretationen und von Reverenzen an die jeweiligen Songs inspirieren: Die Schlagseite zu Creedence Clearwater Revival in ihrer Interpretation von John Lee Hookers ›Boom Boom‹ etwa stammt daher, dass die kurzlebigen wie ungemein erfolgreichen Rocker diesen in ihrem Song ›Suzie Q‹ zitieren, verrät Corabi. Das vergleichsweise weniger bekannte, von Willie Dixon geschriebene und erstmals von Howlin’ Wolf aufgenommene ›Little Red Rooster‹ ist derweil ein ganz persönlicher Wunsch von Band-Initiator und Gitarrist David Lowy.
»Die Rolling Stones haben die Nummer gespielt, als David sie als Kind zum ersten Mal live gesehen hat. Anschließend hat er sein Geld gespart und eine Single des Songs gekauft«, berichtet der Sänger, der jüngst seinen 66. Geburtstag beging. »Wir verbinden mit vielen dieser Lieder persönliche Geschichten. Wobei es nicht alle Ideen auf das Album geschafft haben. Wir haben zum Beispiel auch an Robert Johnsons ›Terraplane Blues‹ gearbeitet. Irgendwann meinte Marti, dass die Nummer zwar cool geworden sei, er aber nichts mehr vom Original erkennen könne. Also haben wir stattdessen ›Sweet Home Chicago‹ aufgenommen. In die Tonne ist unsere Bearbeitung aber nicht gewandert: Ich habe einen neuen Text geschrieben und so wurde daraus ›Take My Soul‹, der letzte Song auf Light ’Em Up. Auf diese Weise sind die beiden Alben auch musikalisch verbunden.«
Mehr Dead Daisies ►ROCKS Nr. 107 (04/2025).