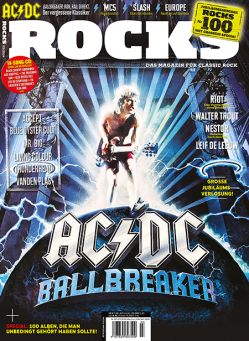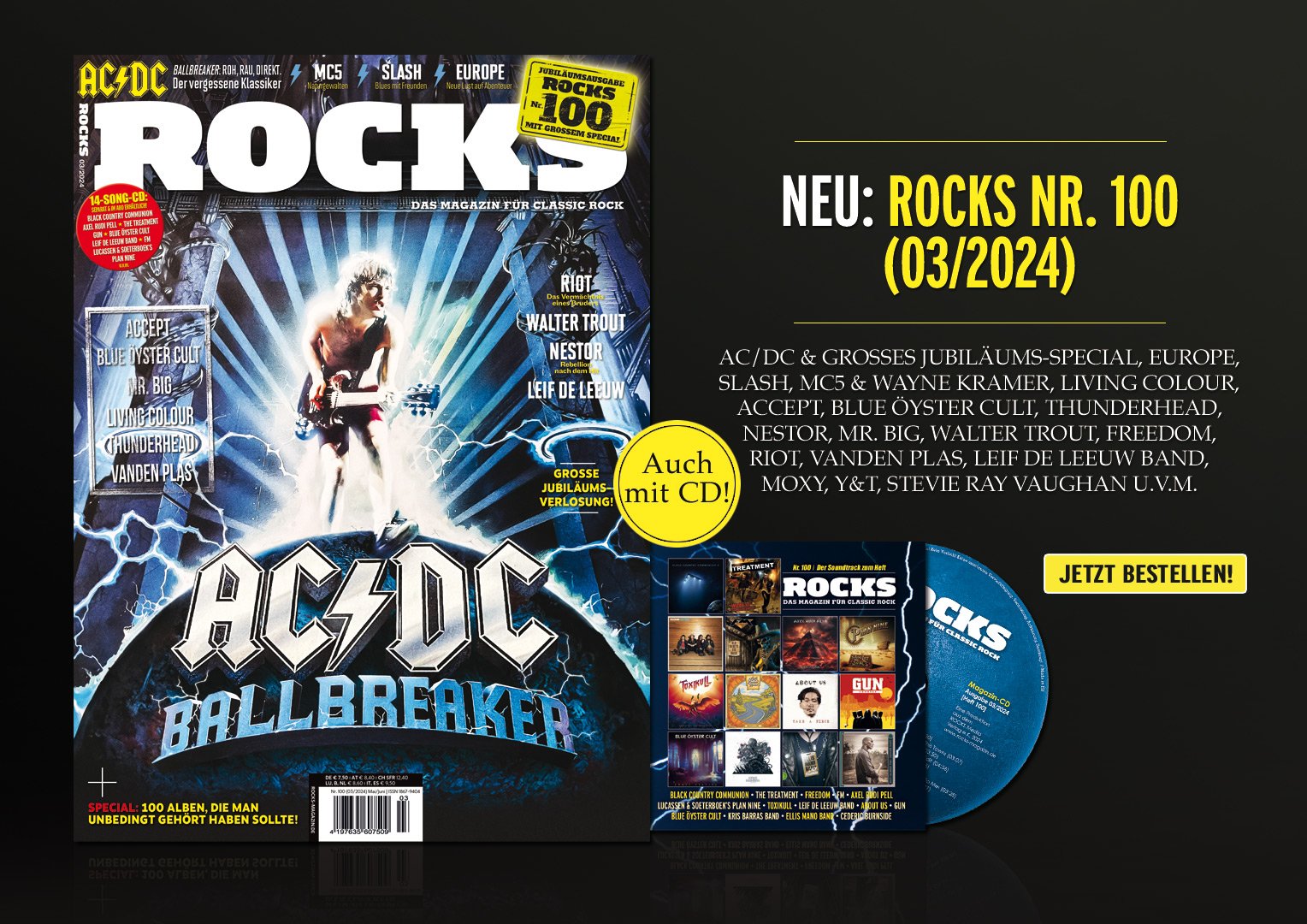Nach ihrem live mitgeschnittenen Debüt dürfte sich kaum jemand eine Vorhersage zugetraut haben, welche Richtung das Ensemble der vormaligen Black Crowes-Gitarristen Rich Robinson und Marc Ford auf ihrem ersten Studiowerk mit eigenen Liedern einschlagen würde: Ein Roots-Jam-Fest, wie es etwa die Tedeschi Trucks Band gerne ausrichtet, schien plötzlich genauso möglich und wahrscheinlich wie ein Einschwenken auf den kompakten Kompositionskurs, der Robinson auf seinen Solo-Scheiben zuletzt immer besser zu Gesicht stand.
Man muss High Water I gar nicht mal besonders aufmerksam zuhören, um zu erkennen, dass sich The Magpie Salute für letztere Variante entschieden haben. Mit vergleichsweise kleinem Bandbesteck: Von den zehn noch auf The Magpie Salute angetretenen Musikern sind neben den beiden Gitarristen nur noch Sänger John Hogg, Bassist Sven Pipien, Keyboarder Matt Slocum und Schlagzeuger Joe Magistro dabei; alles Freunde und Kollegen, mit denen Robinson bereits bei den Krähen, solo oder auch bei den kurzlebigen Hookah Brown zusammenspielte. Introvertierter als vermutet gebärdet sich diese erste Studioarbeit und wirkt in den Melodien zunächst seltsam verschlossen: Für Schnellhörer ist High Water I ganz sicher nicht gemacht, und man tut gut daran, dieses immens tiefgängige Album mit all seinen Feinheiten unterm Kopfhörer wachsen zu lassen. Die Art und Weise, in der Robinson und Ford miteinander verzahnen und als findiges Gitarrentandem interagieren, rückt ihre Musik ganz automatisch in die Nähe der Black Crowes. Und doch greift dieser Vergleich ein ordentliches Stück zu kurz, denn The Magpie Salute sind unüberhörbar eine Band mit eigenem Herzschlag.
Was sie dann auch gleich zum Auftakt mit ›Mary The Gypsy‹ und vorausgeschickten Attacke-Fanfaren demonstrativ unterstreichen: einem vergleichsweise modern anmutenden Lied, das mit seinem ruppig gerupften Riff, dem versteckten Klaviergetacker und Hoggs zunächst noch gewöhnungsbedürftig anmutender Gesangsdarbietung einem Ausfallschritt in Richtung Queens Of The Stone Age nahekommt. So gut und so energisch dieser Song auch ist: Schon mit dem musikalisch gänzlich anders gepolten Titelstück im Anschluss kann er nicht ansatzweise mithalten. Psychedelisch und verträumt verdichtet sich hier jammig-meditatives (Akustik-)Gitarrengewölk, nimmt ein tupfendes Piano und vom Tremolo-Arm der Gitarre behutsam angeschobene Legatoläufe in sich auf und intensiviert sich weiter, bis es bedachtsam wieder zurückgebaut wird und sich Ford und Robinson zum Schluss ganz zärtlich umspielen — als wären Grateful Dead, Led Zeppelin III und die Black Crowes plötzlich eins. Dagegen wirkt das vorab ausgekoppelte ›Send Me An Omen‹ beinahe derb und rabiat und trägt als besonders krähenlastiges Stück mit seinem Gitarrengewusel und den angezerrten Wurlitzer-Sounds beinahe anarchistische Züge.
Gemütlich startet dagegen ›For The Wind‹ mit Klavier, Akustikgitarren und durchs Mellotron gedrückten Streichern, ehe der harsche Radau der Refrain-Slideriffs eine andere Seite von Led Zeppelin als Reverenz auf den Plan ruft. Auch der knorrige Krähen-Rocker ›Take It All‹ lebt von den rostigen Slide-Gitarren, mindestens genauso aber von seinem genial-schlurfenden Rhythmus und nicht zuletzt dem stimmungsvollen Klimperklavier. Geradezu spartanisch und aufgeräumt erscheint im Vergleich ›Sister Moon‹, dessen betont entspannte Melodieführung an Trey Anastasio (Phish) und den späten Tom Petty erinnert. Noch stärker scheinen die versammelten Heartbreakers im wunderbaren ›Can You See‹ und dem abschließenden ›Open Up‹ Spuren hinterlassen zu haben, während ›Walk On Water‹ eindeutige Erinnerungen an einen weiteren früheren Kollaborationspartner Robinsons bei den Black Crowes weckt.
Besonders die Stimmführung in dieser traumhaft-schmissigen Nummer hat einiges von Luther Dickinson und seinen North Mississippi Allstars — auch der aufgemotzte Country-Blues ›Hand In Hand‹ ist eine Nummer, die man ohne Umschweife mit dem Gitarristen in Verbindung bringen würde. Das größte Geschenk auf High Water I ist jedoch das himmlische ›Color Blind‹, das sich unauffällig an der Beatles-Nummer ›I Got A Feeling‹ entlanghangelt und in einem astreinen Black Crowes-Gospel voller Southern-Soul und wohliger Orgel gipfelt, der ohne jede Not auf The Southern Harmony And Musical Companion oder dem Remake-Album Croweology hätte stehen können.
Ein urgemütliches Album, das mit jedem Durchlauf ein Stückchen größer wird: Die Zeiten, in denen Rich Robinson in der allgemeinen Wertschätzung im Schatten seines singenden Bruders und dessen Chris Robinson Brotherhood feststeckte, sollten mit High Water I endgültig vorbei sein.