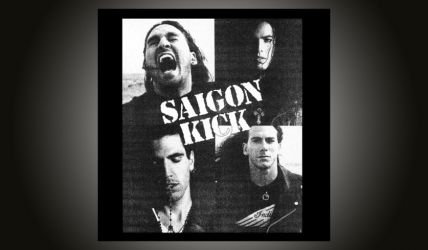Jedes Leprous-Album umweht der Hauch des Ungewöhnlichen. Der kompositorischen Strenge von The Congregation (2015) folgte auf Malina (2017) eine organische Herangehensweise — zu den zahlreichen akustischen Instrumenten wie Konzertgitarre, Klavier oder Streicher gesellen sich nun diverse elektronische Elemente, die man eher mit Trip-Hop, Hip-Hop oder Synthwave assoziiert.
»Kreativität kennt eben keinen logischen Plan«, meint Sänger Einar Solberg. »Das Songwriting gestaltet sich bei uns sehr intuitiv und impulsiv. Je weiter die Arbeit an den Songs voranschreitet, desto dichter wird das Bild. Eine Vision für eine Platte ergibt sich somit immer erst am Ende.« Die Norweger hätten auch zum Stil von Bilateral (2011) oder Coal (2013) zurückkehren können. Die starke Anlehnung an das Genre Progressive Rock sowie die Integration von harschen Metal-Spielarten hat die Band schließlich groß gemacht. Doch das Innovative, das Prog einst ausgezeichnet hat, scheint zu einer Konvention geronnen, meint Solberg.
Um in ihrer Musik nicht stehen zu bleiben, saugen Leprous deshalb zeitgenössische Trends auf, ähnlich wie Rush, King Crimson oder Queen in den Achtzigern. »Wir gehen mit offenen Ohren durch die musikalische Welt. Letztlich musst du mit deiner eigenen Stimme sprechen. Ich bringe aber auch Verständnis für die Fans auf, die da nicht mitziehen«, gibt sich Solberg diplomatisch.
Das Quintett, das sich live mit dem Cellisten Raphael Weinroth-Browne verstärkt, zeichnet sich seit jeher durch sehr differenzierte Instrumentierungen aus. Keine Strophe gleicht der vorherigen, und gerade das rhythmische Fundament von Drummer Baard Kolstad und Bassist Simen Børven mit seinen eng verschlungenen und metrisch gegenläufigen Figuren zieht in den Bann. Die pointiert und subtil gespielten Gitarren von Tor Oddmund Suhrke und Robin Ognedal, die wie in einer Partitur angeordnet sind sowie Solbergs häufig ins Falsett abkippender Klargesang, sind weitere Markenzeichen, die Leprous pflegen.
»Rockmusik zeichnet ein hohes Maß an Nostalgie aus. Seit bestimmt zehn Jahren wird nur noch der Nachlass verwaltet. Gerade was das Zusammenspiel und die Songwriting-Struktur angeht, ist diese Musik ziemlich limitiert. Das Format erschöpft sich schnell, entsprechend ziehe ich Inspiration lieber aus anderen Bereichen. Selbst in den Neunzigern gab es mit Rage Against The Machine, Radiohead oder der Grunge-Bewegung Musiker, die etwas wirklich Neues spielten«, bekräftigt der 34-Jährige seinen Standpunkt und holt direkt noch weiter aus: »Die Stagnation hat, denke ich, auch mit der Entwicklung des Equipments zu tun. Jeder kann mit wenigen Klicks und günstiger Ausstattung professionell klingende Songs aufnehmen. Aber als Musiker sollte man die kreative Atmosphäre, die ein Studio mitbringt, nicht unterschätzen. Queen verbrachten Monate hinter verschlossenen Türen und igelten sich richtig ein in ihrer Welt. Denn wenn die einzige Einflusssphäre ist, dass dein Geist und die Köpfe deiner Mitmusiker interagieren, dann kann etwas Neues entstehen.«
Natürlich hat Solberg dabei im Hinterkopf, dass er mit seiner Band achtzig Tage in Abgeschiedenheit mit den Aufnahmen verbracht hat und fernab einfach zugänglicher, digitaler Wege zahlreiche analoge Abzweigungen nehmen konnte. Dazu passt auch die textliche Ebene, die Pitfalls zu ihrem persönlichsten Album macht: In den letzten eineinhalb Jahren kämpfte Solberg in wiederholt mit Depressionen. »Wir geben uns nicht unserem Leiden hin. Es geht darum, die Kämpfe zu überstehen und sie nicht immer wieder aufs Neue zu führen! Auf eine gewisse Weise ist dieses verrückte Album unser hoffnungsvollstes«, lacht der Sänger.
»Wir Menschen geben uns allzu leicht unseren Ängsten hin. Flugangst ist ein gutes Beispiel. Es gibt Menschen, die erstarren bei dem Gedanken, ein Flugzeug betreten zu müssen, obwohl der Reisende, der neben ihnen sitzt und total ruhig wirkt, das gleiche Risiko hat, abzustürzen. Ich sperre meine Emotionen nicht aus, betrachte sie von einem rationalen Standpunkt. Dennoch bin ich nicht ständig im Zen-Modus. Ich versuche meine geistige Energie durch die Musik zu kanalisieren, damit sie sich nicht in destruktiven Gefühlen verfängt. Das Leben ist nicht immer großartig.
Gerade durch das Auf und Ab erstrahlen die schönen Momente umso heller. Solange die Down-Phasen nicht überwiegen, gehören sie einfach dazu. Wenn man sich allerdings in solch einer Phase befindet, ist die Vorstellung begrenzt, dass es wieder aufwärts gehen könnte. Eine zentrale Erkenntnis, die in ›Alleviate‹ anklingt, ist, dass Warten manchmal die bessere Strategie ist. Man muss sich mit seinen Emotionen anfreunden und darf nicht in Angst vor ihnen erstarren, sonst wird es zu einem Zwang. Jeder Mensch trägt einen Rucksack voller Emotionen mit sich rum, bei mir fahren sie halt eher Achterbahn.«Solberg grinst. »Typisch Künstler halt.«